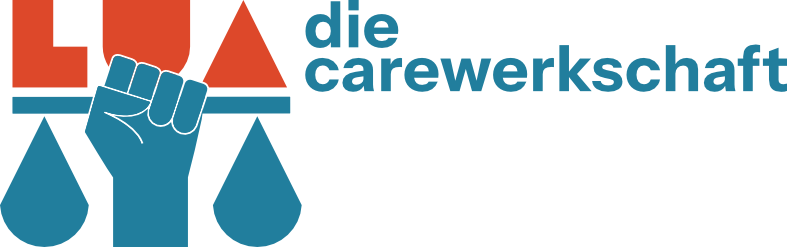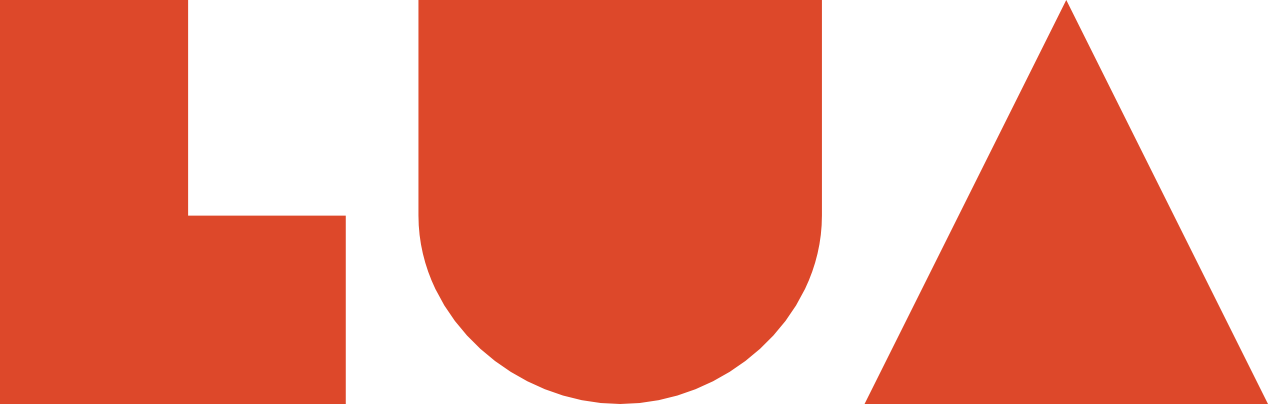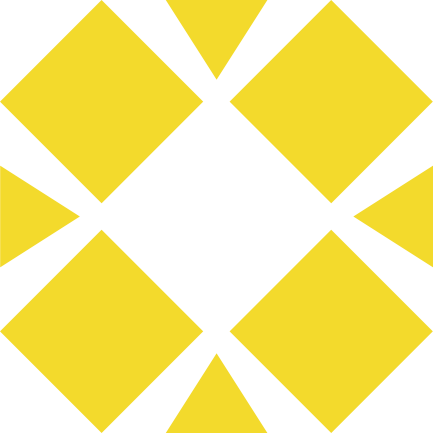
Grundgesetz Art. 3
Die Liga für unbezahlte Arbeit fordert die Aufnahme von familiärer Fürsorgeverantwortung als Diskriminierungsmerkmal ins Grundgesetz
Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung ODER FAMILIÄRER FÜRSORGEVERANTWORTUNG benachteiligt werden.
Doch die Lasten tragen nur wenige. Zu wenige.
Jetzt Petition auf WeAct unterzeichnen!
So argumentiert die Liga
Art. 3 Abs. 1 GG: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“
Art. 3 Abs. 2 GG: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Die systematische Benachteiligung von Sorgearbeitenden verletzt den Gleichheitsgrundsatz doppelt: 1. Sie schafft eine Ungleichbehandlung zwischen Menschen mit und ohne Fürsorgeverantwortung. 2. Sie verfestigt die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, da überwiegend Frauen Sorgearbeit leisten.
Das Grundgesetz erkennt bereits an, dass Fürsorge besonderen Schutz verdient. Art. 6 Abs. 4 GG: „Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.“ Dieser Schutzauftrag ist jedoch zu eng gefasst (nur Mütter), nicht mit konkreten Rechten verbunden und in der Realität nicht wirksam.
Art. 3 Abs. 3 GG besagt: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
Während verschiedene Merkmale und Lebenssituationen explizit im Grundgesetz geschützt sind, fehlt der Schutz für Fürsorgeverantwortung – obwohl diese Arbeit gesellschaftlich notwendig ist und systematische Benachteiligung zur Folge hat.
Die logische Konsequenz ist die Aufnahme der „familiären Fürsorgeverantwortung“ in Art. 3 Abs. 3 GG, um:
1. Den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz für Sorgearbeitende zu verwirklichen.
2. Den staatlichen Auftrag zur Gleichstellung der Geschlechter zu erfüllen.
3. Den verfassungsrechtlichen Schutzauftrag für Fürsorge effektiv umzusetzen.
Nur durch die explizite Nennung als Diskriminierungsmerkmal kann der Verfassungsauftrag zur Gleichberechtigung auch für Menschen mit Fürsorgeverantwortung Realität werden.
Häufige Einwände
„Das betrifft doch nur Frauen, das ist doch mit Geschlecht schon abgedeckt.“
Kritiker*innen könnten argumentieren: Die Diskriminierung aufgrund von Fürsorgeverantwortung ist bereits durch Art. 3 Abs. 2 GG (Gleichstellung der Geschlechter) abgedeckt. Ein zusätzlicher Schutzgrund ist daher überflüssig, es handelt sich um eine „mittelbare Geschlechterdiskriminierung“.
Aber diese Argumentation greift zu kurz:
1. Eigenständigkeit der Diskriminierung
Auch Männer und nicht-binäre Personen werden diskriminiert, wenn sie Sorgearbeit übernehmen. Die Benachteiligung knüpft direkt an die Fürsorgeverantwortung an, nicht ans Geschlecht, daher löst Geschlechtergerechtigkeit allein das Problem nicht.
2. Unterschiedliche Schutzrichtungen
– Art. 3 Abs. 2 GG zielt auf Gleichstellung der Geschlechter
– Der neue Schutzgrund zielt auf Gleichstellung von Menschen mit und ohne Fürsorgeverantwortung
– Beide Dimensionen müssen adressiert werden
3. Verstärkung statt Schwächung
– Die Aufnahme von Fürsorgeverantwortung stärkt auch die Geschlechtergleichstellung, Sie ermöglicht gezieltere rechtliche Interventionen und macht den strukturellen Charakter der Benachteiligung sichtbar.
4. Präzedenzfälle
Auch andere sich überlappende Diskriminierungsmerkmale existieren im GG und die Rechtsprechung kann mit solchen Überschneidungen umgehen. Generell wird Intersektionalität zunehmend rechtlich berücksichtigt.
Die Überlagerung mit der Geschlechterdiskriminierung ist also kein Argument gegen, sondern für die Aufnahme von Fürsorgeverantwortung ins GG. Sie ermöglicht die Präzision des rechtlichen Schutzes, bessere Durchsetzbarkeit und die Anerkennung der komplexen Diskriminierungsrealität.
„Ok, aber in Art. 6 Abs. 4 GG ist ja nur Fürsorge für Mütter genannt, nicht für Fürsorgende allgemein.“
Die Frage nach dem Schutz von Fürsorgeverantwortung im Grundgesetz offenbart eine verfassungsrechtliche Spannung. Während wir die Aufnahme der „familiären Fürsorgeverantwortung“ als Diskriminierungsmerkmal in Artikel 3 Absatz 3 GG fordern, existiert in Artikel 6 Absatz 4 bereits eine Schutzklausel, die jedoch nur Müttern „Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft“ garantiert. Diese historisch bedingte, geschlechtsspezifische Formulierung von 1949 steht in einem potenziellen Widerspruch zu unserem Ziel, alle Menschen mit Fürsorgeverantwortung vor Diskriminierung zu schützen.
Optimal wäre daher eine parallele Änderung beider Artikel. Artikel 6 Absatz 4 könnte modernisiert werden zu: „Jede Person mit Fürsorgeverantwortung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.“ Dies würde Widersprüche beseitigen und ein kohärentes Schutzkonzept schaffen.
Sollte sich dieser umfassende Ansatz politisch als nicht durchsetzbar erweisen, wäre auch die alleinige Ergänzung von Artikel 3 Absatz 3 ein wichtiger Fortschritt. Der spezielle Mütterschutz könnte dann als historisch gewachsenes Minimum neben dem allgemeinen Diskriminierungsschutz bestehen bleiben. Die Rechtsprechung hätte die Aufgabe, beide Normen in ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen.
Entscheidend ist: Die notwendige Modernisierung des grundgesetzlichen Schutzes von Sorgearbeit darf nicht an vermeintlichen Widersprüchen scheitern. Vielmehr muss sie als Chance begriffen werden, den verfassungsrechtlichen Schutz von Fürsorgeverantwortung umfassend und zeitgemäß neu zu gestalten.
„Das ist Privatsache, kein Verfassungsthema.“
Die Kategorisierung von Sorgearbeit als „Privatsache“ verkennt ihre fundamentale gesellschaftliche Bedeutung. Ohne die täglich geleistete Sorgearbeit würde unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem kollabieren. Das Grundgesetz schützt bereits heute zahlreiche Aspekte des Privatlebens, wie etwa religiöse Überzeugungen oder sexuelle Identität. Wenn private Entscheidungen – wie die Übernahme von Fürsorgeverantwortung – zu systematischer Benachteiligung führen, ist der Verfassungsgeber*in gefordert, Schutz zu gewähren.
„Das schadet der Wirtschaft.“
Der vermeintliche Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und dem Schutz von Sorgearbeit ist ein Kurzschluss. Im Gegenteil: Die Aufwertung und rechtliche Absicherung von Sorgearbeit birgt erhebliche volkswirtschaftliche Chancen. Eine bessere Vereinbarkeit von Sorge- und Erwerbsarbeit erhöht die Erwerbsbeteiligung, reduziert Folgekosten im Gesundheitssystem und bei der Altersarmut und erschließt bisher ungenutzte Fachkräftepotenziale. Innovative Arbeits(zeit)modelle, die durch den Verfassungsauftrag gefördert würden, steigern zudem die Produktivität.
„Das ist zu unbestimmt.“
Die vermeintliche Unbestimmtheit des Begriffs „familiäre Fürsorgeverantwortung“ ist kein stichhaltiges Argument. Das Grundgesetz arbeitet an vielen Stellen mit auslegungsbedürftigen Begriffen, die durch Rechtsprechung und Gesetzgebung konkretisiert werden. Das beste Beispiel ist der nachträglich eingefügte Schutz vor Diskriminierung aufgrund von „Behinderung“. Auch hier hat sich gezeigt, dass die Rechtspraxis sehr wohl in der Lage ist, praktikable Definitionen und Nachweisverfahren zu entwickeln.
„Das ist überflüssig.“
Die Behauptung, bestehende Gesetze reichten aus, wird durch die Realität widerlegt. Trotz zahlreicher Einzelgesetze bleiben Sorgearbeitende systematisch benachteiligt. Der Verfassungsrang ist notwendig, um einen grundlegenden Systemwandel einzuleiten. Er verpflichtet den Gesetzgeber zu aktivem Handeln, ermöglicht effektiveren Rechtsschutz und setzt ein wichtiges gesellschaftliches Signal.
„Das ist nicht finanzierbar.“
Die Frage der Finanzierbarkeit muss im Kontext der bereits existierenden Kosten betrachtet werden. Die gesellschaftlichen Folgekosten der Benachteiligung von Sorgearbeitenden – von Gesundheitskosten bis zu Altersarmut – belasten die öffentlichen Haushalte bereits jetzt massiv. Investitionen in den Schutz von Sorgearbeit sind präventive Investitionen, die sich volkswirtschaftlich rechnen. Eine gerechtere Verteilung und bessere Absicherung von Sorgearbeit ist nicht nur sozial geboten, sondern auch ökonomisch sinnvoll.
„Das verstärkt traditionelle Rollenbilder.“
Paradoxerweise ist es gerade die rechtliche und gesellschaftliche Abwertung von Sorgearbeit, die traditionelle Rollenbilder zementiert. Ein verfassungsrechtlicher Schutz würde Sorgearbeit aufwerten und damit auch für Männer attraktiver machen. Erst wenn die Übernahme von Fürsorgeverantwortung nicht mehr zu systematischer Benachteiligung führt, ist echte Wahlfreiheit möglich. Die Verfassungsänderung ist damit ein wichtiger Schritt zur gerechteren Verteilung von Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern.
„Das ist verfassungssystematisch problematisch.“
Die Aufnahme der familiären Fürsorgeverantwortung in den Diskriminierungsschutz des Grundgesetzes folgt der inneren Logik unserer Verfassung. Sie ergänzt die bestehenden Schutzaufträge, schließt eine erkannte Schutzlücke und modernisiert das Grundgesetz zeitgemäß. Die Verfassungssystematik wird nicht gestört, sondern sinnvoll weiterentwickelt – wie es auch bei der nachträglichen Aufnahme anderer Diskriminierungsmerkmale der Fall war.